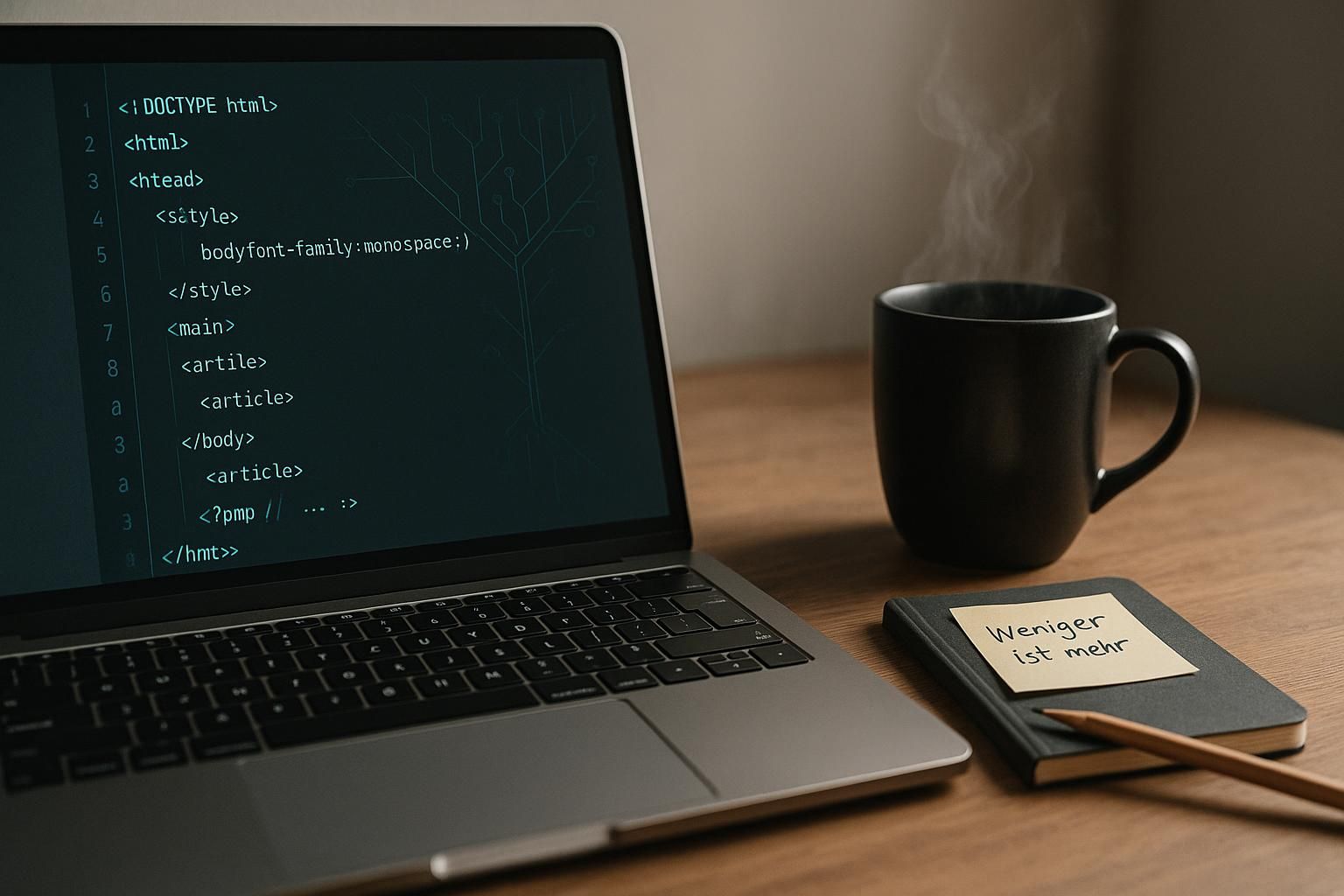Der Geschäftsführer scrollt auf seinem iPhone durch ChatGPT, während er mir erklärt, dass Künstliche Intelligenz in seiner Branche unmöglich funktionieren kann, mit genau dem Werkzeug in der Hand, das seine These widerlegt. Vier Wochen lang wandere ich nun durch deutsche Unternehmen, die sich Transformation auf die Fahnen schreiben, während sie gleichzeitig jeden Fortschritt mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks sabotieren. Dabei begegnen mir immer wieder dieselben vier Gestalten, die ich inzwischen die apokalyptischen Reiter der KI-Verweigerung nenne. Sie reiten auf ihren jeweiligen Steckenpferden durch die Firmengänge und hinterlassen verbrannte Erde, wo Innovation hätte wachsen können.
Der erste Reiter: Die fossile Stagnation
Thorsten-54-SAP-seit-1998 thront in seinem Glaskasten wie ein Museumswärter über seiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Sein Bauch drückt gegen den Schreibtisch, der seit 1998 an derselben Stelle steht, genau wie Thorsten selbst. Die Wände pflastern Zertifikate aus einer Zeit, als man noch Disketten in Computer schob und das Internet pfiff, wenn man es anrief. Daneben hängt ein motivierender Kalenderspruch von 2003: "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit", die Ironie entgeht ihm vollkommen. Er trägt dieselbe Kombination aus hellblauem Hemd und Khaki-Hose, die er in Zehnerpackungen kauft, damit er morgens nicht nachdenken muss. Seine Krawatte hat Kaffeeflecken von 2019, aber das sieht man nur, wenn man genau hinschaut. Er doziert mit der Autorität dessen, der seit zwei Jahrzehnten denselben Bildschirm anstarrt, dass seine Firma bereits alles probiert habe, was die moderne Technik zu bieten hat. "Wissen Sie", beginnt er jeden zweiten Satz, gefolgt von einer Binsenweisheit aus dem SAP-Handbuch von 2001.
Microsoft Copilot zum Beispiel, erzählt er mir, während seine Finger über eine Tastatur huschen, deren Buchstaben längst abgewetzt sind. "Wir haben das evaluiert", sagt er und meint: Zwei Wochen lang hätten drei Azubis damit experimentiert, während er aus sicherer Entfernung zugeschaut hat. Sie haben Excel-Tabellen formatiert, ein paar Formeln ausprobiert, und als die KI einmal eine Spalte falsch sortiert hat, war für Thorsten klar: "Sehen Sie, ich hab's ja gesagt. Auf Maschinen ist kein Verlass."
Thorstens Lieblingsargument ist die Sicherheit. "Was ist mit dem Datenschutz?", fragt er bei jeder KI-Lösung, während er Kundendaten in privaten WhatsApp-Gruppen teilt. "Was, wenn das System ausfällt?", mahnt er, obwohl sein SAP-System jeden Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr "planmäßige Wartung" hat. "Das ist alles noch nicht ausgereift", urteilt er über Technologien, die er nicht versteht, während er Software nutzt, die älter ist als die Praktikanten. Er hat eine Excel-Datei namens "Probleme_mit_neuer_Technik_FINAL_FINAL_v27.xlsx", in der er jeden kleinen Fehler dokumentiert, den je ein digitales System gemacht hat. Gleichzeitig übersieht er, dass seine eigene Fehlerquote bei manueller Dateneingabe bei soliden 15 Prozent liegt. Seine E-Mails beginnen alle mit "Wie telefonisch besprochen" und enden mit "Mit freundlichen Grüßen", auch wenn er innerlich kocht.
Was Thorsten verschweigt, während er seine SAP-Oberfläche streichelt wie andere Leute ihre Katzen: Drei Stockwerke unter ihm verfaulen Prozesse, die älter sind als manche seiner Kollegen. Menschen drucken E-Mails aus, um sie in Ordner zu heften, die andere Menschen dann wieder einscannen, damit dritte Menschen sie als PDF per Mail verschicken können, die Thorsten dann ausdruckt, um sie abzuheften. Er nennt das "bewährte Prozesse" und "gelebte Best Practice". Die Konkurrenz lässt derweil Algorithmen in Millisekunden erledigen, wofür Thorstens Abteilung zwei Wochen braucht. Aber die haben ja auch keine vernünftige Dokumentation, argumentiert er.
Der zweite Reiter: Der galoppierenden Größenwahn
Startup-Steve stürmt zur Glastür herein, als hätte er gerade die Weltformel entdeckt, Red Bull in der rechten Hand, iPhone 17 Pro in der linken, AirPods in den Ohren, die ständig blinken wie eine Lichterkette auf Speed. Mit seinen 28 Jahren und drei Monaten Firmenzugehörigkeit trägt er den Titel "Head of Digital Everything" wie einen Ritterschlag, den er sich selbst verliehen hat, nachdem er dem CEO auf einer Firmenfeier erklärt hat, dass "Legacy-Unternehmen disruptet werden müssen, von innen heraus, checkst du?"
Steve trägt ausschließlich schwarze T-Shirts mit Tech-Konferenz-Logos und dazu eine 800-Euro-Smartwatch, die ihm alle dreißig Sekunden sagt, dass er zu lange sitzt, was er ignoriert, während er im halb Liegen arbeitet. Sein Schreibtisch ist ein höhenverstellbares 3000-Euro-Monster, übersät mit Post-its, auf denen Wörter wie "SYNERGY", "DISRUPT" und "BLOCKCHAIN???" stehen. Er hat sieben Monitore, von denen drei YouTube-Videos über "How to become a 10x Developer" abspielen, während er auf den anderen vier gleichzeitig chattet, coded und PowerPoints baut, die aussehen wie LSD-Trips.
"Leute, wir müssen hier mal butter bei die Fische", beginnt er jedes Meeting, bevor er eine halbe Stunde lang englische Buzzwords aneinanderreiht, die er aus TED-Talks zusammengeklaubt hat. "Das ist nicht skalierbar", sagt er über alles, was funktioniert. "Das hat keinen Impact", urteilt er über profitable Geschäftsbereiche. "Wir brauchen einen Pivot", fordert er monatlich, ohne zu wissen, wovon eigentlich weg. Steve spricht in Superlativen und Disruptions-Vokabular, während er gleichzeitig auf drei Bildschirmen tippt und niemandem zuhört, weil er gerade einen LinkedIn-Post formuliert: "Just had an AMAZING insight about digital transformation! We need to FAIL FAST and BREAK THINGS! #Innovation #Disruption #ThoughtLeader". Er bekommt drei Likes, alle von Recruitern.
Steve sabotiert jedes KI-Projekt, indem er es entweder zu klein oder zu groß macht. Ein simpler Chatbot? "Bro, wenn wir schon KI machen, dann richtig! Wir bauen das neue ChatGPT!" Eine komplexe Prozessautomatisierung? "Viel zu kompliziert, lass uns erstmal mit was Einfachem starten, wie wäre es mit einer KI, die Memes generiert für unsere Social Media?" Er hat 47 angefangene Projekte in seinem "Innovation Lab", von denen keins je über das Konzeptstadium hinausgekommen ist. Die Wände sind vollgeklebt mit Canvas-Modellen, Journey Maps und Sticky Notes in allen Farben des Regenbogens. In der Ecke verstaubt ein 10.000-Euro-3D-Drucker, mit dem er einmal einen Smartphone-Halter gedruckt hat.
"Move fast and break things", zitiert er Zuckerberg, während die Firma stillsteht, weil er gerade wieder alle Systeme auf einmal updaten wollte und dabei die Buchhaltungssoftware geschrottet hat. "Fail fast, fail often", predigt er, während er nie aus seinen Fehlern lernt, weil er sie nicht als Fehler sieht, sondern als "Learnings" und "Opportunities".
Der dritte Reiter: Die rechnerische Kurzsichtigkeit
Controlling-Klaus haust in einem fensterlosen Büro im Keller, das nach abgestandenem Filterkaffee und der Resignation von dreißig Berufsjahren riecht. Die Wände sind tapeziert mit Ausdrucken von Excel-Tabellen in Schriftgröße 6, die er mit Textmarker in vier verschiedenen Farben bearbeitet hat – gelb für "fraglich", pink für "unmöglich", grün für "geht vielleicht" und orange für "auf keinen Fall". Er trägt seit 1997 dieselbe Brille, bei der ein Bügel mit Tesafilm repariert ist, weil eine neue Brille ja 300 Euro kosten würde.
Klaus ist 52, sieht aus wie 65 und benimmt sich wie 75. Er umklammert seine Tastatur, als könnte sie ihm davonlaufen, während er Excel-Tabellen erstellt, die so verschachtelt sind, dass selbst er manchmal nicht mehr weiß, was sie eigentlich berechnen. Seine größte Angst ist, dass jemand seine Makros anfasst. "NICHT ÄNDERN!!!", steht in Zelle A1 jeder seiner Dateien, gefolgt von "Bei Fragen Klaus fragen (Durchwahl 1887)". Die Durchwahl gibt es seit zehn Jahren nicht mehr, aber das hat noch keiner gemerkt.
"Das rechnet sich nicht", ist sein Lieblingssatz, den er schon ausspricht, bevor er überhaupt weiß, worum es geht. KI-Entwicklung? "Zu teuer." Prozessautomatisierung? "Amortisiert sich nie." Moderne Software? "Die Lizenzkosten fressen uns auf." Dabei zahlt die Firma jährlich 100.000 Euro für SAP-Lizenzen, die niemand nutzt, aber das sind "Sowieso-Kosten". Klaus rechnet mit Stundensätzen aus 1995 und Strompreisen aus der Zeit, als es noch D-Mark gab. In seinen Kalkulationen kostet ein Entwickler 15 Euro die Stunde ("mehr sind die nicht wert"), eine KI-Lösung maximal 500 Euro ("ist ja nur Software") und die digitale Transformation insgesamt "höchstens 10.000 Euro, und da ist schon Puffer drin". Wenn ich ihm sage, was echte Entwicklung kostet, macht er dieses Geräusch (eine Mischung aus Schnauben, Lachen und Würgen) und holt seinen roten Stift raus. "Wissen Sie, was wir für das Geld alles kaufen könnten?", fragt er bei jedem Investment und zählt dann Dinge auf, die niemand braucht: "Neue Bürostühle! Einen zweiten Kopierer! Kugelschreiber für zehn Jahre!" Er hat ausgerechnet, dass die Firma bis 2047 mit Kugelschreibern versorgt wäre, wenn man nur auf diese "neumodische Digitalisierung" verzichten würde.
Klaus sabotiert KI-Projekte durch kreative Buchführung. Entwicklungskosten? "Nicht messbar." Zeiteinsparungen? "Hypothetisch." Fehlerreduktion? "Nicht quantifizierbar." Aber wenn die alte Software wieder abstürzt und drei Tage Produktion kostet? "Einmaliger Sondereffekt, nicht repräsentativ." Sein Computer läuft noch mit Windows 7 ("läuft doch noch"), seine Maus hat eine Kugel ("präziser als dieser optische Schnickschnack"), und er druckt E-Mails aus, um sie zu lesen, weil "am Bildschirm kann man nicht vernünftig arbeiten". Er hat einen Taschenrechner neben seinem Computer, weil er Excel nicht traut, nutzt aber Excel für Berechnungen, denen er selbst nicht traut, weshalb er alles dreimal nachrechnet – einmal in Excel, einmal mit dem Taschenrechner und einmal im Kopf. Die Ergebnisse stimmen nie überein, also nimmt er den Mittelwert.
Der vierte Reiter: Die paralysierende Angst
Sabine-aus-der-Buchhaltung sitzt seit 23 Jahren am selben Schreibtisch, in derselben Ecke, mit demselben Ausblick auf die Betonwand des Nachbargebäudes. Sie ist 49, trägt beige Strickjacken über geblümten Blusen und hat ihre Haare in einem Dutt, der seit 2001 gleich aussieht. Ihr Schreibtisch ist eine Festung aus Aktenordnern, die chronologisch von 2001 bis 2025 aufgereiht sind, wobei sie 2007 bis 2009 "sicherheitshalber" doppelt abgeheftet hat, "weil da die Finanzkrise war".
Sabine tippt mit zwei Fingern, aber diese zwei Finger haben eine Geschwindigkeit erreicht, die Maschinenschreiben überflüssig macht. Sie kann blind Rechnungsnummern eingeben, während sie telefoniert, Kaffee trinkt und gleichzeitig ihrer Kollegin Petra erzählt, dass ihre Tochter jetzt "was mit Medien" macht, was sie nicht versteht, aber "Hauptsache, sie ist glücklich". "Das haben wir schon immer so gemacht", ist ihr Mantra, das sie wie ein Schutzschild vor sich herträgt. "Das haben wir noch nie so gemacht", ist ihre Waffe, wenn jemand Neues vorschlägt. "Da könnte ja jeder kommen", ist ihre Ultima Ratio, wenn die ersten beiden Argumente nicht ziehen. Sie hat ein laminiertes Schild an ihrem Monitor: "Änderungen nur mit Unterschrift der Geschäftsleitung", obwohl niemand je Änderungen von ihr wollte.
Bei jedem Wort, das nach Veränderung riecht, zuckt sie zusammen, als hätte jemand mit der Kündigung gewedelt. KI lässt sie nervös an ihrer Perlenkette nesteln, die sie trägt, seit sie hier angefangen hat. "Was ist, wenn die Maschine einen Fehler macht?", fragt sie mit zittriger Stimme und vergisst dabei, dass sie letzte Woche zehntausend statt eintausend Euro überwiesen hat, weil sie "kurz abgelenkt war". Der Fehler wurde zum Glück rechtzeitig bemerkt, aber Sabine hat daraus gelernt: "Man darf sich nicht ablenken lassen", von der Digitalisierung zum Beispiel.
Sabine führt physische Bücher über digitale Vorgänge. Sie druckt E-Mails aus, um sie abzuheften, scannt sie dann ein, um sie zu archivieren, druckt die Scans zur Sicherheit nochmal aus und heftet auch die ab. Sie hat einen Ordner namens "Wichtige E-Mails 2025", in dem jede einzelne E-Mail ist, auch die Einladungen zum Sommerfest und die Erinnerungen, dass der Drucker wieder geht. "Man weiß ja nie", sagt sie und klopft auf den Ordner, als wäre er ein Talisman. Sie hat eine WhatsApp-Gruppe mit Thorsten und Ute aus der Personalabteilung, die heißt "Die Analogen 💪", in der sie Artikel teilen über Hackerangriffe, KI-Fehler und "Beweise", dass Digitalisierung Arbeitsplätze vernichtet. "Hab ich's nicht gesagt?", schreibt sie unter jeden Artikel, garniert mit besorgten Emojis.
Sabines größte Angst ist nicht die Kündigung (sie weiß, dass sie unkündbar ist). Ihre wahre Angst ist die Bedeutungslosigkeit. Dass niemand mehr braucht, was sie kann. Dass ihre handgeschriebenen Notizen, ihre säuberlich geführten Listen, ihre penible Art, alles dreimal zu kontrollieren, plötzlich wertlos werden. Deshalb sabotiert sie still und leise. Sie "vergisst" Zugangsdaten, "findet" wichtige Dateien nicht, ist "krank", wenn Schulungen anstehen.
Das sterbende Pferd, auf dem sie alle reiten
Diese vier Reiter galoppieren auf demselben sterbenden Esel durch die deutsche Wirtschaftslandschaft, der Illusion, dass man den digitalen Wandel aussitzen kann wie einen Schnupfen. Sie glauben fest daran, dass ihre Konkurrenz aus China und den USA irgendwann müde wird, dass die Kunden schon nicht abwandern werden, dass es immer so weitergehen kann wie bisher.
In ihren Meetings sitzen sie zusammen wie die vier Reiter der Apokalypse beim Kaffeekränzchen. Thorsten erklärt, warum die Technik nicht ausgereift ist. Steve unterbricht ihn, um zu erklären, dass sie nicht disruptiv genug ist. Klaus rechnet vor, dass sie zu teuer ist. Und Sabine fragt leise, was eigentlich passiert, wenn sie doch funktioniert. Sie blockieren sich gegenseitig so perfekt, dass keine Idee je das Tageslicht erblickt. Es ist wie ein Perpetuum mobile der Innovationsverweigerung.
Währenddessen sitzt Praktikant Tim, 26 Jahre alt, Master in Data Science mit Bestnoten, in der Kaffeeküche und scrollt durch LinkedIn-Jobangebote. Er kam vor zwei Monaten voller Enthusiasmus, mit einem Kopf voller Ideen und einem GitHub-Account voller funktionierender Prototypen. In der ersten Woche baute er einen Algorithmus, der Rechnungen automatisch verarbeiten könnte. Thorsten sagte: "Interessant, aber passt nicht zu SAP." In der zweiten Woche entwickelte er einen Chatbot für Kundenanfragen. Steve meinte: "Nicht skalierbar genug, wir brauchen direkt eine vollständige KI-Suite." In der dritten Woche präsentierte er eine Kostenkalkulation für ein Pilotprojekt. Klaus lachte so laut, dass man es drei Büros weiter hörte. In der vierten Woche zeigte er Sabine, wie man Prozesse automatisieren könnte. Sie weinte fast und fragte, ob er sie loswerden wolle.
Jetzt, nach zwei Monaten, hat Tim aufgegeben. Er kommt morgens rein, setzt seine Kopfhörer auf und macht das, worum man ihn bittet: PowerPoints formatieren für Thorsten ("Die Folien müssen exakt so aussehen wie 1998"), Buzzword-Bingo-Präsentationen für Steve ("Mehr Raketen-Emojis!"), sinnlose Excel-Tabellen für Klaus ("Kannst du das nochmal in eine andere Formel umwandeln, die zum gleichen Ergebnis kommt?") und ausgedruckte E-Mails für Sabine sortieren ("Chronologisch, aber auch nach Wichtigkeit, aber die Wichtigkeit bestimme ich").
Tim hat eine Textdatei auf seinem Desktop: "Tage_bis_Praktikumsende.txt". Jeden Morgen öffnet er sie und zählt einen Tag runter. Noch 37. Seine Kommilitonen schicken ihm Screenshots von ihren Projekten bei Tesla, DeepMind oder kleinen Startups, wo sie an echten Problemen arbeiten. Tim schickt zurück: "Ich habe heute gelernt, wie man in SAP einen Unterstrich einfügt."
Das Tragische? Tim ist nicht allein. In jedem deutschen Unternehmen sitzen Tims. Brillante junge Menschen, die zu Formatiermaschinen degradiert werden, während die vier Reiter ihre Kreise ziehen. Sie kommen mit Hoffnung und gehen mit Resignation. Manche wechseln ins Ausland, andere zu Startups, die Hartnäckigsten gründen selbst. Und in zehn Jahren kaufen diese Ex-Tims mit ihren erfolgreichen Unternehmen die Firmen auf, in denen Thorsten, Steve, Klaus und Sabine immer noch sitzen und sich wundern, wie das passieren konnte.
Der Preis der Angst
Das Tragische an dieser Apokalypse ist ihre Vorhersehbarkeit. In zwei Jahren werden dieselben Unternehmen panisch Berater anrufen, diesmal für das Dreifache des aktuellen Tagessatzes.
- Thorsten wird dann erklären müssen, warum seine SAP-Kenntnisse plötzlich wertlos sind. Er wird sagen: "Das konnte ja keiner ahnen", während die Konkurrenz bereits seit drei Jahren mit KI arbeitet. Er wird einen "Senior Digital Transformation Consultant" anheuern (der 25 Jahre alt ist und mehr verdient als Thorsten), der ihm erklärt, dass man SAP abschaffen muss. Thorsten wird nicken und heimlich seinen Rentenbescheid prüfen.
- Steve wird endlich verstehen, dass man Revolution nicht predigen, sondern machen muss. Aber es wird zu spät sein. Die echten Innovatoren haben längst geliefert, während er noch PowerPoints baut. Er wird auf LinkedIn posten: "Excited to announce that I'm looking for new opportunities! #OpenToWork #DigitalTransformation #AIExpert" und sich wundern, warum nur Versicherungsvertreter reagieren. Er wird enden als "Agile Coach" bei einem Konzern, wo er anderen Steves erklärt, wie man Sticky Notes an Wände klebt.
- Klaus wird lernen, dass Sparen am falschen Ende das Teuerste ist, was man tun kann. Wenn die Firma verkauft wird (für einen Bruchteil des ursprünglichen Wertes), wird er ausrechnen, was das pro Mitarbeiter kostet, und feststellen, dass es genau die Summe ist, die er in zehn Jahren "gespart" hat. Er wird eine Excel-Tabelle erstellen: "Was_wäre_wenn.xlsx", in der er berechnet, wie reich die Firma wäre, wenn man auf ihn gehört hätte. Die Tabelle wird voller Formelfehler sein, aber das merkt keiner mehr, weil Klaus dann in Frührente ist.
- Und Sabine wird feststellen, dass die Maschinen nicht nur verstehen, was Menschen brauchen – sie machen es auch noch besser, schneller und ohne die passiv-aggressive Note, die Sabine in jede E-Mail packt. Ein Algorithmus wird ihre 23 Jahre Berufserfahrung in drei Wochen lernen und dann höflich fragen, warum sie alles dreimal macht. Sabine wird eine Umschulung zur "Digitalisierungsbeauftragten" machen, bei der sie lernt, wie man PDFs erstellt. Sie wird stolz ihr Zertifikat an die Wand hängen, neben die Urkunde für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit, die sie nie erreichen wird.
Bis dahin wabert weiter dieser süßliche Gestank durch deutsche Büroflure, diese Mischung aus Angstschweiß, abgestandenem Filterkaffee und vertanen Chancen, durchzogen vom Summen alter Neonröhren, die flackern wie die Hoffnung auf Veränderung in den Augen von Praktikant Tim. Es riecht nach dem langsamen Tod des deutschen Mittelstands, gewürzt mit einer Prise Selbstbetrug und garniert mit der Hybris derer, die glauben, die Digitalisierung sei nur eine Phase, wie damals das Internet.
Die vier apokalyptischen Reiter der KI-Verweigerung reiten weiter, Tag für Tag, Meeting für Meeting, PowerPoint für PowerPoint. Sie reiten durch Quartalsberichte und Strategieworkshops, durch Transformationsprojekte, die keine sind, und Innovationslabs, in denen nichts innoviert wird. Sie reiten, bis ihre Pferde tot unter ihnen zusammenbrechen. Und selbst dann, wenn die Firma längst von einem 26-jährigen CEO aus Estland übernommen wurde, der die gesamte Buchhaltung durch drei Zeilen Python-Code ersetzt hat, werden sie noch behaupten, dass das alles nur eine Blase ist. "Warte nur ab", werden sie sagen, während sie ihre Umschulungskurse besuchen, "in ein paar Jahren will wieder jeder echte Menschen und bewährte Prozesse."
Sie werden recht behalten. Nur werden diese echten Menschen und bewährten Prozesse woanders sein. In Shenzhen, in Tallinn, in Tel Aviv. Überall, nur nicht in den fensterlosen Büros deutscher Mittelständler, wo die Geister von Thorsten, Steve, Klaus und Sabine noch jahrelang durch die Gänge wehen werden, als Mahnung dessen, was passiert, wenn man die Zukunft nicht nur fürchtet, sondern aktiv bekämpft.